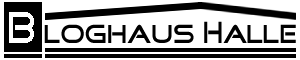Knut Mueller: WIE OSAMA BIN LADEN ENTKAM (Afghanistan 2002)
Vorwort: Zwanzig Jahre nach der Attacke auf das World Trade Center haben die Taliban in Afghanistan die Macht wieder an sich gerissen. Wie das passieren konnte dazu überschlagen sich auch diverse Meinungsäußerungen vermeintlicher Experten, deren einzige Referenz darin besteht, ihre Medienpräsenz mit einem kurzen Aufenthalt im ehemaligen Bundeswehrfeldlager Mazar-e-Sharif aufgebessert zu haben.
Ganz anders der in Halle lebende, überregional bekannte Fotograf und Journalist Knut Mueller, der im Auftrag internationaler Magazine mehr als fünfzigmal kreuz und quer in Afghanistan unterwegs war. Einige seiner zwischen 2001 und 2019 entstandenen Reportagen hat Mueller nun im Rahmen eines Buchprojekts in erzählerischer Form neu verfasst.
So ermöglicht etwa die hier exklusiv präsentierte Doku-Erzählung »Wie Osama Bin Laden entkam« einen bislang unbekannten Einblick in die Welt der Warlords und Clanchefs im mysteriösen Tora-Bora-Gebiet nahe der Grenze zu Pakistan.
Mehr über die fotografische Arbeit des Autors unter http//knutmueller.com.
Erzählung aus Nema Problema:
Knut Mueller: WIE OSAMA BIN LADEN ENTKAM (Afghanistan 2002)
Müde schaute ich auf die Schützenpanzer des britischen Militärkonvois,
versuchte durch verdreckte Scheiben Gesichter zu erkennen. Dann
schloss ich wieder die Augen – und da waren ganz andere Bilder:
Strauchelnde Gestalten in englischen Kolonialuniformen, die sich durch
Eis und Schnee quälten. Dazwischen jede Menge Pferde und Kamele.
Die Bilder – das war der Marsch der Army of the Indus, im Januar
1842, von Kabul nach Jalalabad, wo die Armee nie ankam.
Jalalabad – was für ein klingender Name. Und spottbillig, die lange
Taxifahrt dorthin. Dreißig Dollar.
Der Gewährsmann, Vermittler, Unterhändler, oder was immer er war,
hatte mich abgepasst in dem mit Brettern vernagelten Foyer des
runtergekommenen Interconti-Hotels in Kabul. Warum mich? Ich
würde aussehen wie ein Journalist, wie einer aus Europa, wie einer,
der Interesse haben könnte, an einer exklusiven Story. Ja, er könnte
mich mit Hadji Zaman Ghamsharik zusammenbringen, hatte er
gesagt. Mit dem ruhmreichen Haji Zaman Ghamsharik, der im
Spätherbst 2001 Tora Bora, die letzte und wichtigste Talibanfestung,
zurückerobert hatte. Jetzt, vier Monate später, würden Zamans Milizen
Tora Bora kontrollieren, und ohne seine Erlaubnis würde niemand auch
nur in die Nähe dieses geheimnisvollen Höhlenlandes kommen, so
hatte der Vermittler weiter gesagt. Am nächsten Morgen könnten wir
in seinem Auto nach Jalalabad aufbrechen.
Vor drei Tagen war das. Ich hatte Bedenkzeit verlangt, weil mir der
Typ unsympathisch war – nicht zuletzt wegen seiner Eigenart zu
raunen, wobei er so nah an mich herankam, dass ich seinen Atem
riechen musste –, weil ich nichts über ihn wusste, weil er ein
Talibanemissär hätte sein können, der mich in eine Entführungsfalle
locken wollte, und weil ich noch zwei Tage für meine
Bundeswehrgeschichte brauchen würde, wegen der ich nach Kabul
gekommen war.
Und jetzt saß ich in diesem schrottigen Taxi und war mir immer noch
nicht sicher, ob ich nicht besser umkehren und nach Hause fliegen
sollte. Sicher war dagegen, dass Osama Bin Laden in Tora Bora zuletzt
gesehen wurde, und als sicher galt auch, dass er von dort über die
pakistanische Grenze entkommen konnte. Das war schon was. Also
nicht zurück. Weiterfahren. Augen zu und weiterträumen.
Obwohl den Briten ein afghanisches Ehrenwort – damals, vor 165
Jahren – nach der vorangegangenen Ermordung ihres Statthalters
William MacNaghten nicht mehr viel wert gewesen sein konnte, hatte
sich der kommandierende General, Sir Mountstuart Elphinstone, auf
das ihm zugesagte freie Geleit verlassen und damit 16.000 Menschen
– englische Soldaten, indische Sepoys, die als Hilfstruppen dienten,
Pferdeknechte, Kameltreiber, Offiziersgattinnen, afghanische Diener
mit Frauen und Kindern – in den Tod geführt. Nur einer kam nach
Jalalabad durch: der Militärarzt William Brydon. Er schaffte es, weil ein
Paschtune den flüchtenden Mann in seiner Hütte versteckte, bis der
Blutrausch vorbei war.
Ich versuchte mich zu erinnern, wann und wo ich zum ersten Mal von
dieser Geschichte gehört oder gelesen hatte. Es gelang mir nicht,
manche Dinge sammeln sich an. Jedenfalls war es genau hier, wo all
das geschehen war, und britisches Militär gab es auch wieder auf der
Jalalabad-Road.
Die Passage am Khord-Kabul-Pass ist schmal, die Marschkolonne muss
unendlich lang gewesen sein. Ich sah nach oben, die steilen Felshänge
entlang, stellte mir vor, wie die Deckungslosen von dort gnadenlos
zusammengeschossen wurden – noch dazu mit den neuen englischen
Musketen, denn die waren als Teil des Kapitulationsvertrages den
Afghanen übergeben worden.
Leere Dorfruinen rechts, türkisfarbener Fluss links, dazwischen
rutschte das Toyota-Taxi, in dem ich hinten auf der Rückbank lag und
an Vergangenes dachte, durch schlammige Spurrillen. Die hier lebten,
wurden im zehnjährigen Krieg mit der Sowjetischen Armee vertrieben
oder getötet.
Die letzten Reste der britischen Truppen wurden bei dem Ort
Gandamak niedergemacht. In nur dreizehn Tagen waren 16.000
Menschen auf dieser Strasse umgekommen, im Januar 1842. Erfroren,
erschossen, von afghanischen Säbeln zerhackt. Mehr als die Sowjets
nach zehn Jahren Krieg zu beklagen hatten. Als die Rote Armee 1989
aus Afghanistan abzog, hatte sie knapp 15.000 Mann verloren.
Jahre später saß ich in Kabul mit einem englischen ISAF-Offizier
zusammen. Wir redeten auch über das Drama von Gandamak. Ich
erfuhr, dass britische Soldaten noch heute anhielten, wenn sie dort
vorbei fuhren. Jeder würde dann ausstiegen und schweigend
salutieren, um den gefallenen Kameraden, die sich zuletzt nur noch
mit Knüppeln wehrten, die letzte Ehre zu erweisen.
Wie hatte es soweit kommen können? Darauf hatte der Colonel klare
Antworten:
Erstens war General Elphinstone der unfähigste Offizier, der je in der
Royal Army zu finden gewesen wäre – Friedrich Engels beschrieb ihn
als einen “gichtleidenden, unentschlossenen, völlig hilflosen alten
Mann, dessen Befehle einander ständig widersprachen” – aber die
Kolonialzentrale in Kalkutta setzte auf Elphinstone; wahrscheinlich weil
der Baron erstklassige Verbindungen hatte.
Und zweitens: Die afghanischen Stammesfürsten – allen voran der
Feldherr Dhost Mohammed – hätten Verrat unvorstellbaren Ausmaßes
begangen. Nicht nur, indem sie den fast unbewaffneten
Kapitulationszug der Sechzehntausend entgegen aller Zusicherungen
immer wieder angriffen – auch zuvor, als sie William MacNaghten, den
Vertreter der Krone, zum Verhandeln einluden, nur um dann, kaum
dass die Briten von den Pferden gestiegen waren, über sie herzufallen.
Einer der Engländer wurde geköpft, der Rumpf auf dem Basar zur
Schau gestellt, MacNaghtens Leiche schleifte der Mob durch Kabul.
Da kam es kaum noch darauf an, dass Dhost Mohammed auch
versprochen hatte, die im Kabuler Lazarett zurückgelassenen Kranken
und Verwundeten in Ruhe zu lassen. Stattdessen wurden die Zelte
niedergebrannt und alle Patienten umgebracht.
Wie verabredet, erwartete mich der Mittelsmann in Jalalabad am
Taxiplatz, dem Basar für Transporteure. In feinbestickter Weste über
knielangem Hemd begrüßte er mich in seinem eigenwilligen aber
flüssigen Englisch. Er nannte sich Wakil und er wollte mich mit Hadji
Zaman zusammenbringen. Mehr wusste ich nicht. Und ob er mich
reinlegen wollte oder nicht, war mir inzwischen egal. Es war mir egal,
weil ich durchfallgeschwächt war, und weil mir damals weder meine
private noch meine berufliche Zukunft viel wert gewesen wäre.
Ich wurde in einem von Zamans Gästehäusern einquartiert, ganz in
der Nähe seiner Residenz. Die Wartezeit betrug einen Tag und eine
Nacht. Immerhin gab es fließendes Wasser und ein akzeptables Steh-
Scheißhaus. Außer mir hockten noch an die zwei Dutzend Afghanen in
dem stickigen Raum, tranken Tee und warteten. Einige schon seit
Wochen. Wer müde war, legte sich hin, wo er gerade gesessen hatte.
Während des Wartens fragte ich mich, was ein feudaler Warlord wie
Haji Zaman eigentlich macht, wenn es gerade keinen richtigen Krieg
gibt. Klar, er muss sein Territorium von Rivalen sauber halten, wie
etwa dem Mujaheddin-Kommandeur Hazrat Ali, der auch große Teile
der Provinz Nangharhar kontrolliert, auch unberechenbare
Talibankämpfer sollte ein Regierungstreuer wie Haji Zaman unter
Kontrolle halten, sowohl die einheimischen, wie die radikaleren aus
dem pakistanischen Waziristan, aber das Alltagsgeschäft bestand wohl
darin, Streitereien zwischen einzelnen Clans zu schlichten, Urteile zu
fällen und Strafen zu verhängen; das alles mit dem Ziel, schwankende
Loyalität zu stützen oder neue Bündnisse zu schließen. Deshalb die
vielen wartenden Beschwerdeführer und Bittsteller im Gästehaus. Ein
Warlord muss natürlich über ein wirksames Machtinstrument verfügen,
also über eine bewaffnete Miliz. Ein Teil davon als aktive Kämpfer und
ein größerer Teil als passive Reserve. Da können schnell einige
Tausend Männer zusammenkommen, die ernährt und ausgerüstet
werden müssen. Am einfachsten lässt sich das Geld dafür durch
Wegezoll aufbringen. Deshalb ist ein möglichst großes Territorium
wichtig, weil einfach jeder abkassiert wird, der durch will, besonders
natürlich jene Reisenden, die hochwertige Güter wie Drogen oder
Waffen transportierten.
Aber sicher gab es noch andere Geldquellen, von denen ich nichts
wusste.
Am Nachmittag wurde ich von Wakil abgeholt. Im weitläufigen
Palastgarten, zwischen hohen Palmen und zierlichen Orangenbäumen,
servierte ein alter Diener Tee. Etwas entfernt, unter weißem Zeltdach,
saß eine Gruppe wichtiger Paschtunen mit untergeschlagenen Beinen.
Wie ich kurz vor der Audienz.
Was ich über Haji Zaman Ghamsharik gehört und gelesen hatte,
musste spätestens jetzt zusammengekratzt werden: Gebildet,
feinsinnig und mehrsprachig war er für einige Paschtunen-Clans die
ideale Führungsfigur. Hervorgetan hatte sich Zaman im anti-
sowjetischen Krieg. Danach kämpfte er gegen die islamistischen
Taliban. Als Befehlshaber der 11. Division in Jalalabad musste er 1997
kapitulieren und die Stadt den Taliban überlassen; seinen 5.000
Kämpfern befahl er, die Waffen niederzulegen, er selbst floh ins Exil
nach Paris. Von dort kehrte Zaman erst im Herbst 2001 zurück. Er
witterte das große Spiel. Doch zunächst wetzte er die Scharte von
1997 aus und holte sich mit seinem Warlord-Kollegen Hazrat Ali die
Provinzhauptstadt Jalalabad zurück.
Wie er so zwischen roten und gelben Rosenbeeten daherkam, machte
Zaman den Eindruck eines in sich versunkenen Poeten. Vielleicht
reimte er etwas, während wir auf Englisch plauderten. Manchmal
wirkte er abwesend, dann sah er mich wieder skeptisch an durch seine
goldgerahmte Brille.
Ob die deutsche Agentur, für die ich arbeitete, internationale Partner
hätte, fragte er beim Zupfen eines Rosenblattes, und ob man als freier
Journalist gut leben könne. Die Antworten schienen ihn nicht wirklich
zu interessieren.
Dann wollte Zaman doch wissen, warum ich hergekommen war.
Warum Tora Bora?
Weil eine spannende Geschichte herauskommen könnte, eine, die
Aufsehen erregt, und weil ich immer und überall nach starken
Kriegsbildern suche; der Krieg im Allgemeinen sei mein Thema als
Journalist und als Künstler.
Ah, das wäre ja interessant, Zaman nickte mir freundlich zu.
“Wie war das denn”, kam ich zum Thema, “hatten Sie sich den
Amerikanern angeboten oder sind die auf Sie zugekommen?”
Gleich nach den Anschlägen vom 11. September hätte er sein
französisches Exil verlassen und sich erst mal im pakistanischen
Peschawar eine Basis eingerichtet. Er wollte mithelfen, sein Land von
den Taliban zu befreien, die ihm seinen Sohn und sein Eigentum
genommen hatten. Dort in Peschawar hätten sich Amerikaner bei ihm
gemeldet, die Waffen, Ausrüstung und Satellitentelefone anboten,
auch Geld für Kämpfer, weil sie wussten, dass er, Zaman, dieses
zerklüftete Felsenlabyrinth Tora Bora, in dem sich Bin Laden mit seiner
al-Qaida-Truppe verschanzt hielt, am ehesten würde einnehmen
können.
Patriotisch zurechtgezimmert, altbekannt, dachte ich. Nichts wert,
ohne neue Hintergründe zum Verschwinden Bin Ladens.
Und weiter? Fragend sah ich ihn an, den Kriegsmeister.
Hazrat Ali sei es gewesen, der Bin Laden entkommen ließ, kam es
beiläufig. Zaman nippte vom Minztee. Leider wollten die Amerikaner
nicht nur auf einen Kommandeur setzen, weshalb sie einen Zweiten
anheuerten, eben jenen Hazrat Ali, der auch Referenzen hatte im
Krieg gegen Russen und Taliban. Die Amerikaner hätten Ali sogar
bevorzugt, ihm bessere Waffen und mehr Geld gegeben.
Warum? Weil Ali Afghanistan nie verlassen hatte. Weil sich die
Fundamentalisten hinter ihm scharten.
Aber zu viel Macht verderbe die Menschen, was man bei einem
Emporkömmling wie Hazrat Ali deutlich sehen könnte. Die Araber,
Tschetschenen und Usbeken um Bin Laden wollten auf keinen Fall in
amerikanische Gefangenschaft geraten. Und so hatten sie Millionen
geboten für ihre Flucht in die pakistanischen Stammesgebiete, wo
Glaubensbrüder immer willkommen sind.
Das war schon verrückt: Da ist einer jahrelang in Paris abgetaucht,
kommt zurück, zieht den Armani-Anzug aus und erobert innerhalb von
20 Tagen mit seiner alten Truppe Tora Bora. Nicht ohne
zwischendurch Jalalabad mitzunehmen, und nicht ohne seinen
Mitkämpfer und Rivalen des Verrats zu bezichtigen. Afghanistan pur.
Im Morgengrauen fuhren wir los. Zwei Pick-Up-Trucks, einen
Landrover und achtzehn Bewaffnete hatte Zaman abkommandiert.
Wakil fuhr als Übersetzer mit. Die Sonne kam hoch, es war April, ich
sah Bauern und Kinder in Mohnfeldern arbeiten.
Dann die erste Rast im Gehöft eines Gefolgsmannes. Die Mudjaheddin
wollten frühstücken. Besonders interessierten mich zwei junge
Männer, die ganz offensichtlich verliebt waren, ineinander. Während
der Rast stellten die beiden ihre Kalaschnikows beiseite und
kuschelten ungeniert, ließen sich sogar dabei fotografieren. Der
Anführer, ein graubärtiger Kämpfer mit wachen Augen, ließ es
lächelnd durchgehen. Hafisullah – so hieß der Mann – hatte ein Nokia-
Satellitentelefon und benutzte es oft.
Wie er denn die teuren Sprechminuten bezahle, wollte ich wissen.
Überhaupt nicht. Die Amerikaner hätten jedem, der sich als
Kommandeur ausgab, ein Nokia mit Ladegerät in die Hand gedrückt
und erklärt, dass damit unbegrenzt telefoniert werden könnte.
Hafisullah lächelte, zeigte auf sein Ohr und dann in den Himmel, was
bedeuten sollte, dass die Amerikaner mithörten, dann wählte er eine
neue Nummer.
Die Piste verlor sich mit zunehmender Höhe, wir gingen zu Fuß weiter.
Und das war wirklich eine schöne Gegend. Nicht schroff und kahl, wie
sonst oft in Afghanistan; die Berge anmutig geschwungen und licht
bewaldet. Stellenweise zeugten Krater und verkohlte Baumstümpfe
vom Bombardement der Amerikaner im vergangenen Herbst. Wir
machten Rast und marschierten weiter. Einmal feuerten die
Mudjaheddin unvermittelt mit Panzerfäusten in den gegenüber
liegenden Berghang. Erschrocken ging ich in Deckung.
“Die machen das nur, um Präsenz zu zeigen”, beruhigte mich
Hafisullah.
“Wem wollen sie Präsenz zeigen, sind noch Taliban hier?”
“Ja, von drüben aus Waziristan, und außerdem Banditen.”
“Was ist der Unterschied?”
“Banditen töten dich nicht, die wollen Lösegeld.”
Wieder so ein flacher, steiniger Gebirgsbach. Die Kämpfer hockten sich
nieder, um zu trinken; die beiden Verliebten bespritzten und neckten
sich. Dann kamen wir zur ersten Höhle. Einer großen, aber
augenscheinlich ganz normalen Höhle. An den Gerüchten von
weitverzweigten unterirdischen Tunneln, von befestigten Bunkern mit
Stromversorgung und Lüftungssystemen, von medizinischen
Operationssälen, Schlaf- und Aufenthaltsräumen, schien nichts dran
zu sein.
Ich sah, dass der Höhlenboden komplett mit Munition bedeckt war:
30-Millimeter-Granaten für Flugabwehrkanonen, Tausende von
großkalibrigen Maschinengewehrpatronen und Panzerfaustgranaten,
an den Felswänden gestapelte Kisten mit russischer oder chinesischer
Aufschrift. Weiterzugehen, wäre riskant – das weiß jeder, der sich in
Kriegsgebieten bewegt. Auf dem Balkan wurden verlassene Stellungen
immer vermint oder mit Sprengfallen gespickt. Wenn man die Munition
schon nicht mitschleppen kann, soll der Feind sie auch nicht haben.
Ein dünner Stolperdraht, verbunden mit einer Handgranate, hätte
genügt, um alles in die Luft zu jagen. Aber ich wollte schon rein in die
Höhle; hier hatte keiner vor mir fotografiert. Mein Zögern blieb dem
schlauen Hafisullah nicht verborgen, und so winkte er einem der
Verliebten, die Höhle zu erkunden – als Minenhund, wie jeder wusste.
Sie gingen beide hinein, die Jünglinge; wenn im Paradies, dann
gemeinsam. Wir anderen stellten uns neben den Höhleneingang, um
der hoffentlich ausbleibenden Explosionsdruckwelle nicht im Wege zu
stehen. Nichts geschah, wir gingen rein, ich machte Bilder.
Da stand ich nun in einer der berüchtigten Tora-Bora-Höhlen zwischen
Mudjaheddin, die schon gegen alle und jeden gekämpft hatten,
umgeben von Munitionskisten, auf denen Bin Laden gesessen hatte,
und machte einfach Bilder.
Dann sollte mir die nächste Höhle gezeigt werden. Unterwegs kamen
wir an einem Schutthaufen vorbei. Mauerreste von drei
Lehmziegelhäusern. Ich fand halbverbrannte Papierseiten mit
arabischen Texten und steckte sie ein.
“Das hier war das Gehöft, in dem sich Osama mit seiner Leibgarde,
mit dreißig Ausländern verschanzt hielt”, erklärte Hafisullah. “Die
Amerikaner haben später alles zerbombt. Dabei hätten sie den Scheich
haben können, der konnte nicht weg, war umstellt von uns. Ich selbst
lag mit meiner Gruppe tagelang dort oben hinter dem Bergrücken.”
“Wie, ihr hattet Bin Laden in der Falle und habt ihn abziehen lassen?”
Wakil, der bisher für Hafisullah übersetzt hatte, wandte sich jetzt
direkt an mich: “Sie wollten das Kopfgeld. Warum sollten Zamans
Kämpfer ihr Leben umsonst riskieren. 25 Millionen Dollar hatten die
Amerikaner auf Bin Laden ausgesetzt.”
Er, Wakil, hätte als Unterhändler in Zamans Auftrag mit dem
amerikanischen Verbindungsoffizier telefoniert. Special Forces mit
Hubschraubern hätten kommen sollen; ein GPS-Signalsender war
ausgelegt worden, damit die Amerikaner den Einsatzort auch im
Dunklen finden – aber sie kamen nicht.
Um den Terrorfürsten doch noch zu verkaufen – wenn auch für weit
weniger Geld – will Wakil dann zuerst die britische und danach die
deutsche Botschaft in Islamabad angerufen haben. Aber die hätten
abgewinkt. Bin Laden ginge sie nichts an, Haji Zaman sollte sich an
die Amerikaner wenden.
Und dann?
“Weil niemand Osama haben wollte, ließ Kommandeur Zaman den
Belagerungsring öffnen und die Dreißig nach Pakistan abziehen.
Immerhin waren das Moslems, wie wir alle hier”, erklärte Wakil mit
einem Unterton, der mir nicht gefiel.
Unglaubliche Geschichte – aber was, wenn sie stimmte?
Ich brauchte mehr Futter und wandte mich wieder an Hafisullah: Wo
die anderen Al-Qaida-Kämpfer geblieben wären, wollte ich wissen, und
wieso die nicht versucht hätten, Bin Laden, ihren Führer und Finanzier,
zu befreien.
“Gute Kämpfer waren das”, nickte Hafisullah. “Besonders die
Tschetschenen und Usbeken. Aber sie hätten keine geschlossene Front
zustande gebracht; nur kleine Gruppen, die wenig Proviant hatten.
Viele versteckten sich in Höhlen, um den Bomben zu entgehen.
Besonders die Araber.”
“Und wo war Hazrat Ali, euer Verbündeter?”
“Auf der anderen Seite des Agam-Tals. Einen der Pässe nach Pakistan
hatten seine Leute abgeriegelt.”
Hafisullah wollte jetzt weiter. Wir marschierten zu einer
Mörserstellung, die versteckt in einer Senke lag. Alles war mit
Tarnnetzen überspannt. In einem alten Armeezelt hausten zehn
weitere von Haji Zamans Mudjaheddin. Die Kämpfer begrüßten sich
respektvoll, wie es Krieger tun, die in ihrer eigenen Welt leben.
Scheue Neugier: Sowas wie mich hatte man in Tora Bora noch nicht
gesehen. Die Nacht musste in der Stellung verbracht werden.
Zum Abendessen gab es Schaffleisch, Reis, Joghurt, altes Brot, dazu
Tee. Ich hockte mich neben Wakil, wollte mehr aus ihm herausholen,
aber das funktionierte nicht. Entweder hatte der Mittelsmann schon
alles gesagt, was er wusste – wahrscheinlich aber befürchtete er,
schon zu viel gesagt zu haben. Einmal versuchte ich es noch:
Warum sind die Amerikaner nicht gekommen, um Bin Laden
hochzunehmen, wo sie doch durch dich, Wakil, wussten, dass ihr
Staatsfeind Nr. 1 hier festsaß?
Wakil suchte nach Worten, dann fasste er zusammen:
Die Amerikaner bräuchten diesen personifizierten Feind, weil sie weiter
Krieg führen wollten. Krieg gegen Muslime. In vielen Ländern. Ein
toter oder gefangener Bin Laden hätte diese Kriegspläne in Frage
gestellt, weil ja der Dämon, der Hauptfeind, schon unschädlich sei.
Ich spürte Unwillen. Da war er wieder, der beleidigte Muslim.
Doch das war’s dann. Wakil sagte nichts mehr. Trotzig kaute er auf
einem Stück Brot herum.
Als es Tag wurde, gab es gesüßten Tee. Beim Verabschieden sah ich
noch mal in die Gesichter der beiden verliebten Jungen. Sie blieben in
der Stellung, andere fuhren mit uns zurück.
Im Landrover wirkte Wakil mürrisch, sagte kein Wort. Ich dachte mir,
er könnte Angst haben. Angst davor, dass ich versuchen würde, noch
mal mit Haji Zaman zu reden, um ihn, Zaman, mit der
Kopfgeldgeschichte zu konfrontieren. Dann hätte er was erleben
können, der arme Wakil.
Ob wir in dem Dorf dort unten vorbeifahren könnten, fragte ich,
vielleicht weiß jemand was über Bin Laden.
Das Dorf hieß Landa Kheil. Einer unserer Kämpfer schien hier bekannt
zu sein. Er verschwand und kam mit einem faltigen, kleinen Mann und
dessen Esel zurück. Der Dörfler wollte mit diesem Esel wiederholt
Wasserkanister in das Berggehöft geschafft haben, die Mudjaheddin
hätten ihn durchgelassen. Und ja, es stimmte, dort waren Ausländer,
die kaum Paschtunisch sprachen, ein hagerer Araber mit langem Bart
und durchdringenden Augen, das war der, den sie den Scheich
nannten, das war Osama, der, nach dem ich fragte. Mehr wisse er
nicht.
Hafisullah ermunterte den Mann von der Bombardierung der Höhlen zu
berichten, die vom Dorf aus gut beobachtet werden konnte.
Die Amerikaner bombardierten zwei Wochen lang. Seltsam fanden die
Dorfbewohner, dass neben dem Höhlengebiet nur einer der beiden
Bergpässe nach Pakistan getroffen wurde, der andere nicht – so als
sollten Taliban- und Al-Qaida-Kämpfer in diese Richtung abgedrängt
werden.
Zurück in Jalalabad sah ich einen anderen Haji Zaman. Nicht den
feinsinnigen Intellektuellen – den Warlord mit der Pakoll-Mütze, dem
Markenzeichen der Mudjaheddin. Zaman, diesmal von Bewaffneten
umgeben, wirkte angespannt und hatte wenig Zeit. Es hätte Ärger
gegeben mit der Miliz von Hazrat Ali.
Ob ich in Tora Bora gefunden hätte, wonach ich suchte?
Ja, antwortete ich und bedankte mich für alles.
Fünf Stunden Fahrt nach Kabul. Jalalabad Road. Wieder tauchten
Bilder auf. Diesmal ein trauriger Bin Laden, der allein in dünnem
Büßerhemd durch Schneeberge stapfte. Einmal drehte er sich um und
Haji Zaman winkte aus der Ferne.
Wenige Tage nach meiner Abreise fand Haji Zaman Ghamsharik seine
Residenz mit dem schönen Garten in Jalalabad von massiven Truppen
umstellt. Sie boten ihm freies Geleit nach Pakistan.
Konnte man das so aufschreiben: Die Amerikaner hätten nur die 25
Millionen Kopfgeld zahlen müssen, dann hätten sie Bin Laden abholen
und mitnehmen können. Doch weil sie ihn gar nicht wollten, kamen
und zahlten sie auch nicht, so dass der enttäuschte Kommandeur
Zaman, der Bin Laden festgenagelt hatte, diesen gegen Summe X
laufenließ, obendrein den Verdacht auf Hazrat Ali lenkte, welcher
daraufhin eine Allianz schmiedete, Zaman entmachtete, ihn aber
gegen Summe Y abziehen ließ.
Aus Angst vor Anwälten und Auftragskillern hätte das wohl kein
vernünftiges Blatt gedruckt.
Ich danke Knut Mueller für die Überlassung des Textes. Alle Urheberrechte liegen bei Knut Mueller.